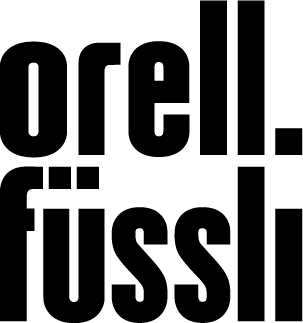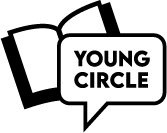Die Wanduhr schlug gerade halb vier in der Nacht, als ich vor das Wohnzimmerfenster trat. Das Licht des Mondes viel durch das zersplitterte Fenster auf mein blasses Gesicht. Ich fühlte gar nichts. Keine Trauer, keine Freude, absolut nichts. Nicht einmal die Schusswunde in meiner rechten Schulter spürte ich. Mein Oberteil war durchtränkte mit rotem Blut und das Messer in meiner Hand blitzte gefährlich im Mondlicht auf. Ich drehte mich um und betrachtete die Männer, die auf dem Boden lagen. Der Boden war rot gefärbt durch das viele Blut. Fünf leblose Körper lagen auf dem Boden verteilt, aus ihren unzähligen Schnittwunden drang jede Menge Blut. Und dann war da noch dieser Junge. Er lehnte gegen den Küchentisch, wie es Dennis getan hat, aber es war nicht Dennis. Er hatte die ganze Tat mitverfolgt. Er hatte gesehen, wie ich meinen Dad erstochen habe, wie mich sein Arbeitskollege an der Schulter getroffen hatte. Ich konnte mich noch daran erinnern. Der Schmerz jagte durch meinen Körper, als würde ich vom Blitz getroffen werden. Aber er hielt nicht lange an. Im Gegenteil. Er machte mich nur noch stärker. Diesen Menschen das Leben zu nehmen war überhaupt nicht schwer. Dieser Junge hatte es ja selbst bewiesen. Jetzt stand er seelenruhig da, sein Blick war auf meinen Vater gerichtet. Nicht einmal bei ihm habe ich etwas gefühlt, als ich ihm das Messer durch sein Herz gerammt habe. Der Junge blickte zu mir auf und ging langsam auf mich zu. Sein Blick war starr auf mich gerichtet. Für mich fühlte es sich wie Stunden an, bis er endlich vor mir stand. Ich wich auch nicht zurück, als er seine Hand ausstreckte und meine Schulter berührte. «Das hast du gut gemacht», sagte er ruhig. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, verschwand aber gleich wieder. Ich legte meine Hand auf seine, die immer noch auf meiner Schulter lag. Sie fühlte sich kalt an, fast schon tot. Als wäre sie abgestorben. Ich blickte ihm in die Augen und fühlte mich glücklich. Sam. Du bist es, dachte ich. Doch das Gefühl von Glück verschwand gleich wieder. Warum freute ich mich? Er war der Junge, der mich fast umgebracht hatte. Ich zog meine Hand weg und trat einen Schritt zurück. Ich hob meine rechte Hand, die immer noch das Messer hielt und stach zu. Aber es verletzte ihn nicht. Er verzog keine Miene. Er stand einfach nur da. Ich sah ihn geschockt an. Kein Blut. Gar nichts. Sam stand einfach nur da, aber etwas war anders. Er verschwand langsam, als würde er sich auflösen. Und das passierte wirklich. Ich blinzelte schnell mit den Augen und ein lautes Geräusch erklang in meinen Ohren. Plötzlich war alles schwarz. Und ich fiel und fiel und fiel….
Ich blickte mich langsam um. Der Raum, in den ich mich befand, hatte nichts mehr mit dem zerstörten Haus zu tun, in dem ich gerade noch gewesen war. Meine Jacke hing über einem Bürostuhl, aber sie war gar nicht blutgetränkt. Sie sah einfach nur sauber aus. Erst jetzt viel mir auf, dass ich auf einem Sofa lag, das mitten in einem hell beleuchteten Raum stand. Neben dem Sofa befanden sich zwei schlichte Stühle. Ein Bürotisch stand neben einem grossen Fenster und einen Holzregal. Zu sehen waren ein Computer und jede Menge Bücher. Ich setzte mich langsam auf, doch mein Körper schrie förmlich auf vor Schmerzen. Stöhnend legte ich mich wieder hin und atmete ein paar Mal ein und aus. Nach einer Weile fing ich langsam an, mich aufzusetzen. Meine Muskeln brannte wie Feuer, aber ich schaffte es, mich aufzusetzen. Gerade als ich mich aufgesetzt hatte, öffnete sich die Tür und ein Mann trat ins Zimmer. Er trug eine einfache Jeans und ein blaues Hemd. Erleichtert atmete ich auf. Es war mein Dad. Er blickte mich mit einer Mischung aus Besorgnis und Ärger an. Ohne ein Wort zu sagen ging er auf mich zu, den Blick die ganze Zeit auf mich gerichtet, und setzte sich vor mich auf einen der Stühle. Eine ganze Weile sagte niemand von uns etwas. Dann atmete mein Dad kurz ein und fragte mich: «Wie fühlst du dich?» Ich konnte an seinem Gesichtsausdruck nicht deuten, ob er wirklich besorgt oder einfach nur enttäuscht oder sogar verärgert war. «Gut» sagte ich leise. Ich wollte nicht irgendwelche Fragen beantworten. Alles was ich wissen wollte war, ob das alles wirklich passiert war. Mein Dad blickte kurz auf den Boden, als ob er nicht wusste, was er als nächstes sagen sollte. «Ich kann mir gut vorstellen, dass du sehr verängstigt bis», sagte er schliesslich. Ich blicke ihn an. Wie bitte? Was meinte er damit? «Aber du kannst mir vertrauen. Schliesslich bin dein Dad, Vanessa.» Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Irgendwie schüchterte mich das alles ein. Aber ich wollte Antworten. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und fragte: «Was ist passiert?» Ich fürchtete mich vor der Antwort, aber ich wollte wissen, was mein Dad darüber dachte. Doch mit dem was er sagte, hatte ich nicht gerechnet. «Wir fanden dich in dem Haus, von deinem Klassenkameraden Dennis. Zufällige Passanten haben gemeldet, dass aus diesem Haus Schrei zu hören waren. Natürlich sind wir sofort gekommen und was habe ich gesehen?» Ich zuckte zusammen. Mein eigener Dad würde mir sagen, dass ich eine Mörderin bin. Er würde mich festnehmen und wegsperren. «Du lagst neben Dennis. Du hattest wohl das Bewusstsein verloren. Dennis war allerdings tot. Wir konnten mehrere brutale Stichverletzungen feststellen.» «Das wollte ich nicht!», schrie ich auf einmal. Ich war den Tränen nah. «Er hat mich angegriffen, er hat Alex getötet. Er wollte mich töten!» Mein Dad war aufgesprungen und sah mich schockiert an. «Vanessa, wovon redest du? Du hast doch niemanden getötet» Mein Dad wollte mich in den Arm nehmen, aber ich war bereits aufgesprungen und wich ängstlich zurück. «Bitte, mein Kind. Hör mir zu», sagte mein Dad mit ruhiger Stimme, allerding konnte er ein Zittern nicht verbergen. «Dennis wurde nicht von dir getötet, du hast ihm nichts getan. Im Gegenteil. Den Spuren nach zu urteilen hast du dich nur verteidigt, weil er dich womöglich angegriffen hat. Du hast nichts Schreckliches getan. Der Einzige, der etwas Schreckliches getan hat, war Dennis.» Er machte eine Pause und sah mich an. «Aber wer ist dieser Alex?» Mit dieser Frage hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Hatten sie seine Leiche nicht gefunden? Mein Dad schien meine Gedanken zu hören und fügte hinzu: «Die einzigen Personen in diesem Haus, waren du und Dennis.» Ich dachte ich würde gleich ohnmächtig werden. Hatte ich das nur geträumt? Hatte ich Dennis nur aus Notwehr ermordet? Oder war noch jemand anderes im Haus? Und das wichtigste, wo war Alex? Hätte mein Dad mich nicht gestützt, wäre ich auf die harten Fliesen geknallte. Ich spürte das meine Beine nachgaben und mein Dad mich schnell wieder auf das Sofa legte. Besorgt sah er mich an. «Du musst dich ausruhen. Du hast mehrere Stichverletzungen», sagte er. Erst jetzt bemerkte ich die weissen Verbände, die um meine Arme gebunden waren. Und auch erst jetzt setzten die Schmerzen wieder ein. Ich zuckte zusammen, als ich vorsichtig über die Verbände strich und vor lauter Erschöpfung verlor ich wieder das Bewusstsein.
Ich wachte auf und erkannte, dass ich in einem Krankenhausbett lag. Der Raum roch streng nach Desinfektionsmittel. Die Wände und Möbel waren strahlend weiss und durch das halb geöffnete Fenster hörte ich die Geräusche der unzähligen Autos und Menschen, die sich draussen aufhielten. Ich richtete mich langsam um und dreht meinen Kopf. Ein Glas mit Wasser fiel in mein Blickfeld. Es stand auf einem kleinen Tische neben meinem Bett. Meine Kehle war ausgetrocknet und schrie mir zu, ich soll sofort etwas trinken. Ich griff nach dem Glas und trank das Wasser in einem Schluck aus. Und schon fühlte ich mich etwas besser. Neben dem Bett sah ich auch noch frische Kleidung, eine Jeans, ein blaues T-Shirt und eine Jacke, schön zusammengefaltet und mein Handy lag daneben. Am Ende des Bettes erblickte ich auch noch einen Rucksack. War es meiner? Ich konnte mich nicht erinnern. Wie lange war ich bewusstlos, fragte ich mich. Ich sah an mir herunter, die weisse Krankenhauskleidung lag auf meiner Haut und fühlte sich sehr locker an. Ich legte die Bettdecke beiseite und setzte mich aufrecht hin. Abgesehen davon das mir noch ein wenig schwindlig war und mein rechter Arm ein wenig weh tat, ging es mir gut. Ich setzte mich aufrecht hin und stand langsam auf, um mich umzuziehen. Als ich meine Kleider gewechselt habe, fühlte ich mich endlich wieder wohl. Ich zog mir schnell die Jacke über, da ich etwas fror, und wartete. Irgendwann wird doch wohl jemand kommen. Auf einmal vibrierte es in meiner Jackentasche. Seltsam. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass mein Handy in der Tasche war. Ich nahm es heraus und betrachtete das Display. Drei Nachrichten. Schnell entsperrte ich mein Handy und sah mir die Nummer an. Eine war von meiner Mum die andere von Dad. Aber die dritte Nummer sagte mir überhaupt nichts. Nicht schon wieder. Ich spürte, wie sich mein Puls beschleunigte und mein Herz so schnell anfing zu schlagen, dass es schon fast drohte, aus meiner Brust zu springen. Ich wollte nicht aber irgendetwas in mir sagte, ich soll die Nachricht öffnen. Und das tat ich auch. Es standen nur zwei Wort da.
DU LEBST
Ich zuckte zusammen, als ich die Nachricht sah. Bitte nicht schon wieder. Aber es war noch nicht alles. Eine zweite Nachricht erschien.
HEUTE KOMME ICH
Ich schluckte schwer. Das konnte einfach nicht wahr sein. Ich spürte, dass ich zu zittern begann. Meine Beine gaben nach und ich stürzte mich gegen den Tisch. Die wenigen Gegenstände, die darauf waren, eine Tasse und ein paar Bücher, stiess ich mit einem lauten Schluchzen nach unten. Die Tasse zerbrach und die Splitter verteilten sich im ganzen Raum. Ich atmete schwer. Das konnte nicht wahr sein. fast schon ängstlich betrachtete ich mein Handy. Tränen rannen mir übers Gesicht. So viele Gedanken schossen mir durch den Kopf. Beobachtet mich jemand? Wollte sich jemand rächen? War es ein unbekannter oder kenne ich diese Person? Plötzlich war ich wütend. Ich konnte mich einfach nicht mehr unter Kontrolle behalten. Mit einem lauten Schrei schleuderte ich mein Handy zu Boden. Dann stürzte ich selbst zu Boden und schlug laut schreiend auf ihn ein. Ich schlug immer und immer wieder auf den harten Boden. Das war also der Punkt, an dem ich verrückt wurde. Meine Hand war bereits rot, aber ich spürte keinen Schmerz. Ich schlug einfach weiter. Mein Handy lag neben mir, ein grosser Riss zog sich über das Display. Ich beachtet es nicht. Ich hörte auch nicht wie sich die Tür öffnete und plötzlich wurde ich von starken Händen nach oben gezogen. Es war mein Dad. Doch ich hatte mich immer noch nicht unter Kontrolle. Ich schlug um mich, trat mit den Beinen aus und schrie mir die Seele aus dem Leib. Die Person, die mich hielt, sagte etwas, aber ich hörte nicht, nur mein eigener Schrei nahm ich wahr. Eine zweite Person kam in das Zimmer und versuchte mich zu beruhigen, doch ich hörte nicht auf zu schreien. Mein Dad versuchte mich auch zu beruhigen, aber es gelang auch ihm nicht, also liess er mich los. Da ich nicht damit gerechnet hatte, stürzte ich nach vorne und stiess gegen das Krankenhausbett. Mein Kopf dröhnte und ich atmete immer noch schnell. Ich spürte einen leichten Schmerz an meiner Hüfte, da wo ich gegen das Bett gestürzt bin, aber das Adrenalin schoss so schnell durch meinen Körper, dass ich den Schmerz nur kurz war nahm. Endlich konnte ich mein Gedanken wieder zu ordnen. Doch da war nur einer. Ich wollte weg von hier! Und zwar schnell. Ich stützte mich immer noch auf das Bett, als mich eine Hand sanft auf der Schulter berührte. Blitzschnell drehte ich mich um, ich spürt die Wut in mir aufkommen. Jetzt standen vor mir drei Personen. Ein Arzt, eine Krankenschwester und mein Dad. Ich blickte sie wütend an. Wenn Blicke töten könnte, dachte ich mir. Die Krankenschwester trat ein wenig näher und hob die Hände. «Vanessa», begann sie, «Es ist alles gut.» «Halte sie den Mund!», schrie ich. Ich konnte das nicht kontrollieren, die Worte kamen einfach nur so aus mir raus. Seltsam. Es fühlte sich an, als würde ein anderer für mich sprechen. Mein Dad kommt langsam auf mich zu und hebt die Hände. Er wollte mich doch nur beruhigen. Mit einem hasserfüllten Blick wich ich zurück. Die Krankenschwester kam näher, ihr Blick war erfüllt mit Sorge. Ich starte sie an und als sie direkt vor mir stand tat ich es. Ich holte aus, stiess die Frau zu Boden, schnappte meinen Rucksack und stiess den Arzt und meinen Dad mit einem lauten Schrei zur Seite. Ich stiess die Tür auf und rannte auf den Gang hinaus. Patienten und Krankenschwester blickten mich schockiert an. Es war mir egal. Ich rannte den Gang entlang und steuerte direkt auf die Treppen zu. Ich nahm immer zwei Stufen auf einmal. Angst hinzufallen hatte ich nicht. Ich rannte die Treppe hinunter und stiess plötzlich gegen eine Krankenschwester. Durch den Schwung warf ich sie zu Boden und ich selbst konnte mich noch mit knapper Not halten. Ein Arzt war hinter mir erschienen und schrie mir etwas hinterher, aber ich war bereits weiter gerannt und steuerte direkt auf die grosse Glastür zu, die nach draussen führte. Durch pure Angst und Hass getrieben stiess ich die Tür auf und rannte einfach weite, direkt auf die Strasse zu. Ohne anzuhalten hechtete ich über die Strasse ohne Rücksicht auf irgendetwas oder irgendjemand zu nehmen. Das Hupen der Autos, die wütenden Passanten, die wütenden Fahrer, sie alle waren mir egal. Ich rannte, als würde mein Leben davon abhängen. Auf einmal kam mir ein Gedanke. Wohin soll ich gehen? Ich war so durcheinander, dass ich das Mädchen gar nicht bemerkte, dass mit dem Blick auf ihr Handy gerichtet, meinen Weg kreuzte. Ich konnte nicht mehr anhalten, konnte nicht mehr ausweichen. Mit voller Wucht rammte ich das Mädchen und wir fielen beide rückwärts über den Bürgersteg direkt vor ein heranfahrendes Auto. Der Fahrer des blauen SUV bremste haarscharf ab und schrie uns an. ich lag ausgestreckt auf dem Bauch vor direkt vor der Stossstange des SUV. Das Mädchen lag neben mir auf dem Rücken. Ihre Stirn blutete. Ich wollte ich nicht helfen, sondern einfach nur verschwinden. Erschrocken stellte ich fest, dass mir meine Beine nicht gehorchten. Panik stieg in mir auf. Waren sie gebrochen oder gelähmt? Das Mädchen richtet sich auf und hielt sich die Hand an die Stirn. Dann starte sie mich an. Mit Mühe unterdrückte ich einen Schrei. Ich hatte damit gerechnet, dass das Mädchen weinen würde oder einfach nur geschockt wäre. Aber so war es nicht. Sie starte mich an. Ich Blick war voller Hass. Ich betrachtete ihr schmales Gesicht, ihre dunklen Haare, ihre Kleider. Erst jetzt viel mir die Ähnlichkeit zwischen uns auf. Als würde ich in mein Spiegelbild blicken. Aber warm sah sie mich so an? Eine Passantin blieb stehen und schrie auf, als sie meine Verbände sah ich sah an meinen Armen hinunter. Blut. Helles Blut. Die Verbände waren nicht mehr weiss, sie waren rot. Rot wie Blut. Auch andere Passanten waren stehen geblieben und starten mich an. Manche geschockt, andere verwirrt, wiederum andere, was mich am meisten verwunderte, mit einem Finster Blick. Mein Blick flog über die einzelnen Gesichter und glitt am Schluss wieder zu dem Mädchen. Sie war inzwischen aufgestanden und heilt eine Hand an die Stirn. Das Blut tropfte zwischen ihren Finger auf den Boden. Der blosse Anblick des Blutes liess mich erschaudern, also tat ich das Einzige, was ich noch konnte. Ich stand so schnell wie es mein Körper erlaubte, auf und drängte mich schnell zwischen der Menge hindurch. Die Menschenmenge schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Überall wo ich hinblickte starten mich die Menschen an. Endlich hatte ich es aus der grossen Menge geschafft. Ich rannte weiter, liess die Menschen hinter mir, die wie angewurzelt dastanden. Ich wollte nur noch nach Hause. Endlich hatte ich es geschafft. Das Haus meiner Eltern stand immer noch vor dem grossen Garten und wurde durch die untergehende Sonne perfekt beleuchtet. Ich fragte mich wie viele Tage wohl vergangen waren seitdem ich bei Alex war? Alles, woran ich mich noch erinnern konnte, war, dass Dennis, mein bester Freund tot war. Und was war mit Alex? Warum hatten sie ihn nicht gefunden? Als ich auf die Vorfahrt trat, wo unser schwarzer Wagen stand, fühlte es sich nicht wie mein Zuhause an. Es fühlte sich sehr fremd an. Auch als ich das Haus betrat, wobei es mich nicht wunderte, dass die Haustür offen war, fühlte es sich nicht wie meine vertraute Umgebung an. Viel mehr wie eine Fremde. Eine, in der ich noch nie war, in der ich mein Leben noch keine Sekunden verbracht habe. Ich ging ins Badezimmer und wühlte in unserem kleinen Medizinschrank herum, bis ich ein paar frische Verbände gefunden habe. Vorsichtig löste ich die alten Verbände und betrachtete die kleinen Schnittwunden, die auf meinen Armen verteilt waren. Es waren unzähligen. Ich wollte das nicht länger sehen, also verband ich sie schnell wieder. Als ich wieder in das Wohnzimmer trat, blieb mir fast das Herz stehen. Meine Mutter sass auf einem Stuhl, in ihrem Blick lag purre Sorge. Sie sah aus, als hätte sie geweint. Als sie mich erblickte stand sie auf, trat vor mich und umarmte mich. Ich war so überrascht, dass ich die Umarmung nicht ablehnte oder verhinderte. Ich schlang meine Arme um sie und drückte sie ganz fest. Endlich wieder zu Hause. Nach einer Weile liess meine Mutter mich los und sie lächelte ich erleichtert an. «Ich bin so froh, dass du noch da bist», sagte sie nur und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Ich wusste nicht was ich sagen sollte also blickte ich einfach zu Boden. «Ich habe gerade Tee gemacht, willst du welchen?», fragt sie mich schliesslich. Ich brachte eins schwaches ja zu standen und nickte. Ich setze mich an den Esstisch und meine Mutter gab mir eine Tasse mit dampfendem Tee. Der Duft war wunderbar, Pfefferminz und ein wenig Honig, wie ich es liebte. Meine Mutter setzte sich gegenüber von mir hin. Ihr Blick war auf meine verbundenen Arme gerichtet. Bis auf ihre gekräuselten Haare sah sie gut aus. Ich ahnte, dass sie jetzt viele Frage haben würde. «Wie fühlst du dich?», begann sie. Ich wusste es nicht. «Ich bin ok», sagte ich einfach. Es stimmte zwar nicht ganz, aber ich wollte sie nicht beunruhigen mit diesen Nachrichten. Dabei glitt mein Blick automatisch auf das Handy, dass aus meiner Jackentasche herausragte. Der Bildschirm war angegangen und ich sah eine Nachricht. Mein Herz klopfte wieder doppelt so schnell. Ich nahm das Handy mit zitternder Hand aus meiner Tasche und las die Nachricht.
Bist du Bereit?
Ich war verwirrt. Was wollte die Person mir sagen? Es kamen zwei weitere Nachrichten.
Ich bin Hier
Immer
Was meinte der Schreiber damit? War er hier im Haus? Erneute Panik ergriff mich und ich konnte mich nur schwer beherrschen ruhig zu bleiben. Meine Mutter sah mich an. Sie war nicht besorgt, oder ängstlich, einfach nur neutral. «Was ist los?», fragte sie mich. «Hat dir jemand geschrieben?» Plötzlich wurde ich wütend auf sie. Ihre Fragerei nervte mich. «Das geht dich nichts an», Ich konnte ein Zittern nicht unterdrücken. Meine Mutter starte mich kurz an, konnte sich dann aber wieder fassen. Es war mir egal, was sie dachte also liess ich den Rest meines Tees einfach stehen und stand auf. Plötzlich packte meine Mutter mich am Arm und drückte auf meinen Verband. Ich schrie auf, mehr vor schock als vor Schmerz und starte sie verzweifelt an. Als sich ihr griff verstärkte schrie ich auf. «Mum, was tust du da?» Tränen schossen mir in die Augen. Doch sie antwortete nicht. Sie starte mich einfach nur an. Dann bewegten sich ihre Lippen «Es tut mir leid.» Ohne ein weiteres Wort zu sagen zerrte sie mich zur Kellertreppe. Ich war so geschockt, dass ich mich nicht wehren konnte. Mein Körper schrie, ich soll mich losreissen, aber meine Muskeln reagierte nicht. Ich fühlte mich schwach und verletzlich. Der Tee, schoss es mir durch den Kopf. Hatte sie etwas hineingegeben? Meine Mutter hielt mich mit ihrem eisernen Griff fest und ich konnte nichts anderes machen, als mit ihr die Stufen hinunter zu laufen. Sie brachte mich in die Wäschekammer und steckte den Schlüssel zwischen zwei Regalen in ein verstecktes Schloss. Ein Knirschen war zu hören, als das eine Regal zur Seite schwang und einen einzelnen Raum zum Vorschein brach. Eine einzelne Glühbirne hing von der Decke und auf einem Tisch lag ein grosses Messer. Ich hatte ein Deja vu. Das Messer, der kalte Raum, der Mörder, die Aussichtlose Lage. Meine Mutter griff nach dem Messer und drückte mich gegen die Wand. Sie presste ihre Hand auf meine Kehle und ich bekam kaum noch Luft. Endlich hatte ich den Schock überwunden. Es kostete mich so eine Überwindung, meine Muskeln in Bewegung zu setzen, aber es gelang mir. Ich wollte mich von der Wand wegdrücken, aber ihr Griff war so stark, dass ich kaum noch atmen konnte. Ich schlug mit den Händen auf sie ein aber mit jeder Sekunde, die verstrich, wurde ich schwächer und schwächer. Tränen rannen über mein Gesicht. Ich konnte es einfach nicht mehr zurückhalten. «Was…tust…du…da?» brach ich mühsam hervor. Der Griff lockerte sich ein wenig, aber ich hatte immer noch Schwierigkeiten, um Luft zu holen. Zu meiner Überraschung blickte mich meine Mutter mit Trauer in den Augen an. Sie hob das Messer uns hielt es vor meine Augen. Ich wollte Schreien, aber mein Mund war wie ausgetrocknet. «Ich muss das tun.», sagte meine Mutter mit zittriger Stimme und stach zu. Ihre Worte taten fast mehr weh als die Messerspitze, die sich in meinen Bauch bohrte. Ich schrie auf. Sie zog das Messer wieder hinaus und jetzt lag ein anderer Blick in ihren Augen. Wut. Eiskalte Wut. Ich würgte und presste eine Hand auf die schmerzende Wunde, aber ich lebte noch. Doch meine Mutter lies mich immer noch nicht los. Sie hob das Messer ein zweites Mal und ich sah wie die blutrote Spitze auf mich zu kam. Doch dann hielt sie innen. Ein dumpfer schlag war aus der dunklen Ecke des Raumes zu hören und meine Mutter drehte ihren Kopf zur Seite. Ich stöhnte auf und musste hart kämpfen, um nicht das Bewusstsein zu verlieren. War da noch jemand? Vielleicht jemand der mir helfen konnte? Ich sah an meiner Mutter vorbei und nahm eine Bewegung war. Da lag jemand. Es war ein Junge mit braunen Haaren. Der Schmerz war auf einmal wie vergessen. Ich starte den Jungen an. Das war Alex! Alex lebte. Wie konnte das sein? Er sah furchtbar aus. Seine Kleidung war verdreckt und blutverschmiert. Sein Gesicht war blutüberströmt. Wie konnte er noch leben? Er bewegte sich kaum merklich und stöhnte kurz auf. Das war alles. Meine Mutter starrte ihn finster an. Sie stiess mich schmerzhaft zu Boden, trat vor den Jungen und stach auf ihn ein. Ich stöhnte laut auf als ich auf dem Boden lag und presste meine Hände auf meinen Bauch. Meine Mutter hörte auf, mit dem Messer auf Alex einzustechen und drehte sich zu mir um. Ich hob meinen Kopf ein wenig und sah mit schmerzverzehrten Gesicht nach oben. Der Schnitt war zum Glück nicht sehr tief, ich schaffte es mich auf die Knie zu stemme. Kalte Tränen rannen über mein Gesicht. Ich konnte einfach nicht glauben, was hier passierte. Das war meine Mutter, die auf mich eingestochen hatte. Das musste ich wohl oder übel akzeptieren. Aber kampflos würde ich nicht aufgeben. Meine Mutter wollte mich umbringen, aber ich würde nicht einfach so aufgaben. Sie erhob das Messer in die Höhe. Ich rechnete damit, dass sie zustossen würde, aber nichts geschah. Ich versuchte ihrem Blick standzuhalten, wofür ich meine ganze Willenskraft aufwenden musste. «Es tut mir leid», meine Mutter stand da, völlig bewegungslos. «Es ist unsere Pflicht, die zu verlassen, die wir lieben. Und alle die uns aufhalten» Ich war verwirrt. Meine Mutter blickte kurz nach hinten und betrachtete den toten Jungen. Auch wenn es nur für einen Moment war, war es trotzdem genug. Sie war abgelenkt. Und das nutzte ich aus. Die Schmerzen lähmten mich fast, aber ich schaffte es, mich nach oben zu stemmen. Ich warf mich mit aller Kraft gegen meine Mutter und brach sie zu Fall. Meine Mutter schrie auf und das Messer glitt ihr aus der Hand. Das Adrenalin schoss durch meinen Körper und verdrängte die Schmerzen. Meine Mutter lag auf dem Rücken und wollte aufstehen, aber ich warf mich auf sie und versuchte sie daran zu hindern, an das Messer zu kommen. Doch so leicht machte sie es mir nicht. Meine Mutter stiess mir die Faust in den Magen und ich glitt mit einem lauten Schmerzensschrei von ihr herunter. Sie hielt meine Arme mit ihrem Gewicht auf dem Boden und begann mich zu würgen. Die Erinnerung an meinen Geburtstag drohte mich zu überwältigen. Panik drohte mich erneut zu lähmen und ich rang nach Luft. Ich versuchte mich nach oben zu stemmen, aber meine Mutter drückte mich mit ihrem ganzen Gewicht auf dem Boden. Ihre Hände fühlten sich an wie Stahlklammern, die sich immer fester um meinen Hals zuzogen. Wie durch ein Wunder bekam ich meine Hände frei und da ich mich nicht von ihrem eisernen Griff befreien konnte, versuchte ich das Messer zu greifen. Ich streckte meine Hand aus und spürte den Griff aber ich hatte kaum noch kraft. Meine Mutter schien das nicht zu stören. Ich sah es in ihren Augen. Sie wollte mich nicht mehr erstechen, sie wollte mich ersticken. Auf einmal kam mir ein Gedanke. Meine beste Freundin hatte mir mal diesen Trick gezeigt. Wenn man von Jemanden gewürgt wird, sollte man versuchen den Unterleib mit den Beinen zu treffen. Und das tat ich. Mit einem letzten verzweifelten Versuch stemmte ich meine Knie mit voller Wucht in den Unterleib meiner Mutter. Sie stöhnte auf und liess automatisch meinen Hals los. Ich griff nach dem Messer und zog mich an der Wand hoch. Meine Mutter lag immer noch auf dem Boden aber ihr Blick war auf mich gerichtet. Dann griff sie mich plötzlich an. Ich war so geschockt, dass ich fast den Halt verlor. Sie war auf die Füsse gesprungen, also tat ich das Einzige, was ich noch machen konnte. Ich stemmte mich von der Wand weg, stach mit dem Messer zu und stürzte dann halb kriechen halb stehend aus dem Raum. Mir war egal ob ich meine Mutter verletz hatte oder sogar getötet. Ich wollte einfach nur nach oben. Meine Wunde blutete immer noch und die Schmerzen traten wieder ein, als ich die Treppe nach oben stolperte. Die letzte Stufe brach mich zu fall und ich stürzte mit dem Gesicht nach vorne auf den Fussboden. Da kam mir der Albtraum wieder in den Sinn denn ich drei Tage vor meinem Geburtstag geträumt habe. Ich krümmte mich zusammen und schrie auf. Der Schmerz war unerträglich geworden, aber ich musste weiter. Mit einer schier unmöglichen Kraft zog ich mich an dem Esstisch nach oben, das Messer immer noch fest umklammert, und lief so schnell wie ich konnte zur Tür. Sie stand immer noch offen, das war gut. Hinter mir hörte ich, wie jemand meinen Namen rief. Erneute Schmerzen traten ein und ich stützte mich gegen das Regal, was neben der Tür stand. Ich drehte mich um und sah, wie meine Mutter sich mühsam aufzurichten versuchte. Ihre Kleidung war blutüberströmt und zerrissen. Ihr Blick war nicht mehr mit Trauer gefüllt, sondern mit Hass. Ich drehte meinen Kopf zur Haustür wieder um und erstarrte. Sie hielt eine Waffe in den Händen, pechschwarz, und ihr Gesicht war immer noch rot von dem vielen Blut. Es war das Mädchen, was ich vorhin auf die Strasse gestossen habe. Ihr Blick war voller Verachtung. Sie hielt die Waffe direkt auf meinen Kopf gerichtet. «Wirklich schade, dass wir uns nicht noch länger unterhalten konnten», sagte sie mit rauer Stimme und drückte ab. Ich war wie erstarrt. Nichts funktionierte mehr, mein Körper hatte aufgegeben. Der Schuss war ohrenbetäubend.
Aber er galt nicht mir. Ich öffnete die Augen und blickte automatisch zurück. Meine Mutter war zusammengebrochen, die Blutlache unter ihrem Körper wurde immer grösser. Ich konnte es nicht fassen und wand schnell den Blick ab. Das Mädchen warf die Waffe zu Boden. Sie blickte mich an. Endlich hatte dieser Albtraum ein Ende.
Dann griff sie mich an. es kam so plötzlich, dass sie mich einfach umwarf und ich im Nuh unter ihr begraben war. Mit der einen Hand hielt sie ein Messer in die Höhe, mit der anderen hielt sie mich fest. Die Luft wurde aus meiner Lunge gepresst und ich war noch verwirrter als vorher. «Warum?», stiess ich mühsam hervor. Das Mädchen hielt in der Bewegung innen. Sie betrachtete mich nachdenklich mit ihren giftgrünen Augen, als würde sie überlegen, ob sie das wirklich tun sollte. «Es gehört dazu», sagte sie eiskalt, «Wir sind daran gebunden. Damit unsere liebsten nicht leiden, erlösen wir sie schnell davon.» Ich konnte nicht glauben, was sie da sagte. «Und alle die sich uns in den Weg stellen», fügte sie hinzu. Ich musste automatisch an meine Mutter denken, die tot hinter mir lag. Das war doch verrückt. Das alles war zu viel für mich, aber aufgeben kam nicht infrage. Dann kam mir eine Idee. Vielleicht köntne ich Zeit gewinnen.
«Gehörte Sam auch dazu? Und Dennis?», sagte ich so laut ich konnte. Ich sah es an ihrem Blick, dass ich recht hatte. Sie zögerte, antwortete dann aber: «Die Beiden hatten es fast geschafft. Als Sam versagt hatte, mussten wir ihn beseitigen.» Ich wusste, was sie damit meinte. Es gelang ihm nicht, mich umzubringen, also wurde er umgebracht. Hatten sie auch Dennis umgebracht? Und was war mit Alex, dem Bruder von Sam? Als könnte sie meine Gedanken hören antwortete das Mädchen: «Dennis hatte leider auch versagt, also mussten wir ihn ebenfalls töten. Leider waren wir zu spät und du warst schon weg.», sie machte eine Pause. Ich fragte sofort weiter, bevor ich noch vor lauter Angst ohnmächtig wurde: «Was war mit Alex?» Sie blickte mich mit einem hinterlistigen Lächeln an. «Ach der liebe Alex. Er war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort.»
Das war es also.
Ich wusste nicht was ich antworten sollte. Ich spürte, wie die Tränen in mir hochkamen, aber ich wollte nicht weinen. Nicht dieses Mal. «Aber das spielt jetzt eh keine Rolle mehr. Denn jetzt werde ich all diese Fehler korrigieren.» Ich begriff sofort, was sie meinte.
Ich war der Fehler.
Ich musste handeln, bevor sie es tat.
Mit aller Kraft riss ich meinen Arm nach oben und schlug sie mitten ins Gesicht. Ich hatte endlich wieder neue Energie, das Mädchen hatte nicht damit gerechnet. Sie schrie auf und rollte von mir herunter. Ich griff nach der Hand mit dem Messer und versuchte es ihr zu entreissen. Sie versuchte mir das Messer in die Brust zu stossen und wir rangen darum. Doch das Mädchen gab auch nicht so leicht auf. Sie schleuderte mich gegen den Tisch und ich musste mich abstützen, um nicht wieder umzufallen. Ich rechnete damit, dass sie mich sofort umbringen würde, aber es geschah nichts. Dann, auf einmal, spürte ich einen stechenden Stich in meinem Rücken. Ich schrie auf und verlor fast das Gleichgewicht. Sie zog das Messer wieder aus meinen Rücken und wollte erneut zustechen. Warum konnte sie es nicht einfach zu Ende bringen?
Mir blieben höchstens noch ein paar Sekunden. Ich wurde fast ohnmächtig von Schmerz, dann sah ich die Blumenvase. Sie stand direkt vor mir. Das war eine Chance. Mit einem lauten Schrei griff ich danach und schleuderte sie herum. Ich traf genau dahin, wo ich wollte. Das Mädchen viel nach hinten auf den Rücken, ihr Kopf war blutüberströmt, eine Scherbe steckte in ihrem rechten Auge. Das Messer hatte sie fallen gelassen. Mit letzter Kraft griff ich danach und rammte es ihr, ohne zu zögern mitten ins Herz.
Es war vorbei, endgültig. Ihr Schmerzerfüllter Schrei war das letzte, was ich von ihr hörte. Dann war nur noch stille. Das Messer steckte immer noch in ihrer Brust, aus dem rechten Auge und der Stirn rang ununterbrochen feuerrotes Blut heraus. Ich wand den Blick ab und lehnte mich mit schmerzverzerrtem Gesicht gegen die Wand. Da kam mir ein Gedanke. Wo war eigentlich mein Vater?
Wie aufs Stichwort, hörte ich laute Sirenen von draussen. Das ist jetzt ein wenig zu spät, dachte ich mir. Aber es war mir egal. Er würde auf jeden Fall geschockt sein. Neben mir lagen zwei tote Frauen. Sie waren beide Opfer, ich selbst wusste nicht mehr, was ich war.
Ein Opfer? Oder ein Mörder?
Ich erinnerte mich an die ersten Nachrichten, die ich bekam.
Hallo, ich bin ein Mörder. Diese Nachricht blieb für immer in meinem Gedächtnis.
Das gleiche konnte ich jetzt von mir behaupten.
Ich wollte die beiden Frauen nicht mehr sehen, also schloss ich die Augen. Ich konnte nicht mehr denken, nichts mehr sagen. Ich wollte meine Augen nie mehr wieder öffnen. Doch dann hörte ich sie. Die Stimme. Vielleicht war es Einbildung, vielleicht auch nicht. Ich konnte sie so deutlich hören, dass ich dachte, der Junge stünde direkt neben mir. «Das hast du gut gemacht», flüsterte Sam. Mit einem kurzen lächeln erwiderte ich diese Worte und die Dunkelheit umhüllte mich.